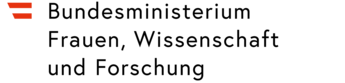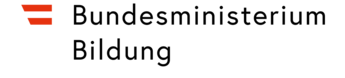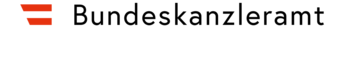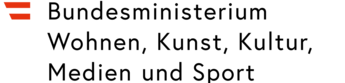Kooperations-partnerschaften

Kooperationspartnerschaften sind Kooperationen von
- mindestens drei Einrichtungen
- aus drei verschiedenen Programmländern
Kooperationspartnerschaften unterstützen Entwicklung, Transfer und Implementierung innovativer Praktiken ebenso wie gemeinsame Initiativen zur Förderung von Zusammenarbeit, Peer-Learning und Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene.
Ziel Ihrer Zusammenarbeit kann sein, Qualität und Relevanz der Aktivitäten der Einrichtungen zu erhöhen, Partnernetzwerke aufzubauen und zu stärken, Kapazitäten für länderübergreifende Zusammenarbeit und Internationalisierung der Aktivitäten zu erhöhen und dabei neue Praktiken, Methoden und Ideen zu entwickeln bzw. auszutauschen.
Ergebnisse der Kooperationspartnerschaften sollten wiederverwendbar, übertragbar und anpassbar und nach Möglichkeit transdisziplinär sein. Verbreitet werden sie auf lokaler, regionaler, nationaler und länderübergreifender Ebene.
- Laufzeit: zwölf bis 36 Monate
- Förderhöhe: 120.000, 250.000 oder 400.000 Euro pro Projekt
Programmschwerpunkte und Prioritäten
Das Programm Erasmus+ gibt jährlich verschiedene bildungspolitische Prioritäten vor. Kooperationspartnerschaften leisten mit ihren Ergebnissen Beiträge zu deren Erreichen. Kooperationspartnerschaften können diese Schwerpunkte inhaltlich aufgreifen und ein Projekt zu einer oder mehreren Prioritäten durchführen.
Unabhängig von der Themenwahl sollen sich die horizontalen Prioritäten im Projektdesign widerspiegeln.
Jedes Projekt muss mindestens eine der vier horizontalen oder eine spezifische Priorität der Schulbildung ansprechen (siehe Programmleitfaden Teil B, Key Action 2).
Für Österreich sind keine nationalen Prioritäten vorgesehen.
Horizontale Prioritäten – Schwerpunkte der KA2 für alle Erasmus+ Sektoren
Spezifische Prioritäten für den Bereich Schulbildung
… durch Überwachung, frühzeitige Ermittlung gefährdeter Schüler/innen, präventive und an den Lernenden orientierter Ansätze, Förderung des Wohlbefindens von Lernenden und Lehrkräften sowie Schutz vor Mobbing. Auf Schulebene unterstützt die Priorität ganzheitliche Ansätze für den Unterricht und die Zusammenarbeit zwischen allen internen und externen Akteuren. Auf strategischer Ebene soll der Übergang zwischen den Bildungsphasen sowie die Bewertung und Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen verbessert werden. Ziel ist es, allen Lernenden, insbesondere Lernenden mit geringeren Chancen, Erfolge zu ermöglichen.
Ziel dieser Priorität ist es, den Aufbau von Kapazitäten von Schulen, Lehrkräften und Schulleitungen zu unterstützen, um das Wohlbefinden in der Schule unter Berücksichtigung eines schulübergreifenden Ansatzes anzugehen. Projekte im Rahmen dieser Priorität können die Förderung des Wohlbefindens (sowohl in Bezug auf die psychische als auch die körperliche Gesundheit) von Lernenden und Lehrkräften als Schwerpunkt haben, bei dem es darum geht, ein positives Schulklima zu schaffen, das soziale und emotionale Lernen von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung bis hin zur Sekundarstufe II in den Lehrplan zu integrieren und die Schaffung sicherer Schulen und den Schutz vor allen Formen von Gewalt in der Schule sicherzustellen, einschließlich Mobbing, Cybermobbing und geschlechtsspezifischer Gewalt. Ein zweiter Schwerpunkt dieser Priorität ist die Förderung professioneller Lerngemeinschaften und der Zusammenarbeit mit der breiteren Gemeinschaft, insbesondere mit Fachkräften aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie mit Eltern.
… durch Stärkung der Erstausbildung sowie der fortlaufenden Weiterbildung von Lehrkräften mittels Verbesserung des politischen Rahmens und Möglichkeiten für Mobilität, ferner durch attraktivere und vielfältigere Gestaltung der Karrieremöglichkeiten für Lehrkräfte und verbesserte Auswahl, Anwerbung und Evaluierung für Lehrberufe. Außerdem soll die Entwicklung einer stärkeren Schulleitung und innovativer Lehr- und Bewertungsmethoden unterstützt werden.
… durch die Förderung der fächerübergreifenden Zusammenarbeit, den Einsatz innovativer Lernansätze, die Entwicklung von Kreativität, die Unterstützung der Lehrkräfte bei einem kompetenzorientierten Unterricht und die Entwicklung der Fähigkeit zur Bewertung und Validierung von Schlüsselkompetenzen.
… durch die Integration der sprachlichen Dimension in die Lehrpläne und den systematischen Einsatz neuer Technologien zum Sprachenlernen. Ferner durch Schaffung sprachenbewusster Schulen, frühzeitige Förderung des Sprachenlernens und -bewusstseins und die Entwicklung zweisprachiger Unterrichtsmöglichkeiten soll sichergestellt werden, dass Lernende bis zum Ende des Pflichtschulabschlusses ein angemessenes Niveau an Sprachkompetenz erreichen.
… durch die interdisziplinäre Lehre in kulturellen, umweltbezogenen, designbezogenen und anderen Kontexten. Dazu gehört die Entwicklung und Förderung effektiver und innovativer pädagogischer Konzepte und Bewertungsmethoden. Wichtig dabei ist der Aufbau von Partnerschaften zwischen Schulen, Unternehmen, Hochschuleinrichtungen, Forschungseinrichtungen und der Gesellschaft. Auf strategischer Ebene liegt das Ziel in der Entwicklung nationaler MINT-Strategien.
… anhand des EU-Qualitätsrahmens für eine hochwertige frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung. Ziel ist es, einerseits die Erstausbildung sowie Weiterbildung des gesamten an der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung beteiligten Personals und andererseits die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Strategien und Praktiken zur Förderung der Teilnahme aller Kinder, einschließlich Kindern mit geringeren Chancen, zu unterstützen.
Unterstützt wird die Einbettung grenzüberschreitender Klassenaustausche in Schulprogramme, der Aufbau der Kapazitäten von Schulen für die Organisation von Lernaufenthalten im Ausland und die Einrichtung langfristiger Partnerschaften zwischen Schulen in verschiedenen Ländern. Es wird das Ziel verfolgt, die Schulbehörden auf allen Ebenen stärker in Bemühungen um die Anerkennung von Lernergebnissen einzubeziehen sowie die Entwicklung und den Austausch von Instrumenten und Praktiken zur Vorbereitung, Überwachung und Anerkennung von Auslandsaufenthalten zu fördern.
Im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über eine europäische Hochschulstrategie zielt diese Priorität auf die Einbeziehung führender Persönlichkeiten aus Start-up-Unternehmen ab, die als Botschafter und Mentoren fungieren sollen, um junge Menschen zu inspirieren und sie zu motivieren, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln.
Im Rahmen dieser Priorität werden Projekte unterstützt, die der Umsetzung, Verbreitung und Förderung inklusiver pädagogischer Ansätze und arbeitspraktischer Verfahren dienen, die auf aus der Ukraine geflohene Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte in der Schulbildung ausgerichtet sind. Die Projekte im Rahmen dieser Priorität sollen auf hohen Qualitätsstandards und umfangreichen Erfahrungen bei der Integration von Neuankömmlingen in Bildungs- und Berufsbildungsumgebungen aufbauen. Sie können beispielsweise auf Folgendes abzielen: Bereitstellung von Sprachangeboten, Anwendung und Ausweitung der Forschung, Austausch mit ukrainischen Einrichtungen, Ermittlung bewährter Verfahren zur Unterstützung des psychosozialen Wohlergehens von vor dem Krieg geflohenen Lernenden und Beschäftigten usw.
Förderfähige Einrichtungen
Erasmus+ fördert Kooperationspartnerschaften zwischen allen möglichen Einrichtungen, die in den Bereichen Bildung, Jugend, Sport oder anderen sozioökonomischen Sektoren agieren, ferner auch Einrichtungen mit sektorenübergreifender Ausrichtung (wie etwa Behörden, Einrichtungen für Anerkennung und Validierung, Sozialpartner, Handelsorganisationen, Beratungszentren, Kultur- und Sporteinrichtungen).
Wer kann einen Förderantrag stellen?
Jede in einem Programmland ansässige Einrichtung (juristische Person) kann die Förderung einer Kooperationspartnerschaft beantragen. Die koordinierende Einrichtung richtet den Förderantrag im Namen aller Projektpartner an die nationale Agentur ihres Landes. Als Partner, nicht jedoch als Antragsteller, kommen auch Einrichtungen aus Partnerländern in Betracht, sofern deren Beteiligung einen wesentlichen Mehrwert für das Projekt bringt. Partnerländer sind grundsätzlich alle Drittstaaten, die nicht an Erasmus+ teilnehmen. Zusätzlich können assoziierte Partner beteiligt sein, die keine Fördermittel aus dem Projekt erhalten. Sie können etwa die Projektergebnisse verbreiten helfen und zur nachhaltigen Wirkung beitragen.
Einzelpersonen können die Förderung einer Kooperationspartnerschaft nicht beantragen.